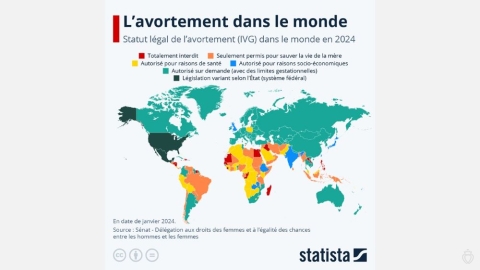Diplomatische Entspannung zwischen China und dem Vatikan

Kathedrale von Pékin
Wird es in naher oder ferner Zukunft einen Apostolischen Nuntius in Peking geben? Die gleiche Frage kann auch anders gestellt werden. Wird Taiwan die Kosten für die derzeitige China-Politik des Heiligen Stuhls tragen? Dies könnte man meinen, wenn man einige Signale betrachtet, die anlässlich der Reise von Papst Franziskus in die Mongolei vom 2. bis 4. September 2023 aufgetreten sind.
Zur Erinnerung: Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China im Jahr 1951 wurde die Nuntiatur nach Taipeh verlegt, wo sie fortan ihre Funktion als „Brücke zwischen der Weltkirche und den chinesischen Katholiken“ wahrnahm, wie es Rom damals wollte.
In seinem Streben nach einer Annäherung an das chinesische Festland, das lange vor dem derzeitigen Pontifikat begann, schwächte der Heilige Stuhl jedoch seine Präsenz in der ehemaligen Formosa ab und ließ nur noch einen Geschäftsträger vor Ort.
Im September 2018 unterzeichneten die Volksrepublik China und der Heilige Stuhl dann ein vorläufiges Abkommen, das den Papst unter anderem dazu ermächtigte, Bischöfe zu ernennen, die zuvor von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt worden waren.
Die taiwanesischen Katholiken akzeptierten diese versöhnlichen Gesten gegenüber den roten Mandarinen, wenn auch mit einer gewissen Bitterkeit, da sie befürchteten, dass dies ein Zeichen für den zukünftigen Verlust der Unabhängigkeit der Insel sein könnte.
Diese Befürchtungen werden sich auch nach der apostolischen Reise des Pontifex in die Mongolei Anfang September 2023 nicht zerstreuen. Wenige Tage vor dieser Reise nutzte der Erzbischof der chinesischen Hauptstadt am 28. August die feierliche Messe zur Eröffnung des Diözesanseminars in Peking, um in seiner Predigt ein ganz besonderes Gebet zu formulieren, in dem er „die rasche Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und China“ forderte.
Wenn man bedenkt, dass Giuseppe Li Shan, ein von Rom anerkannter chinesischer Bischof, Vorsitzender der Patriotischen Vereinigung der Katholiken Chinas geworden ist, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gesteuert wird, ist man geneigt zu glauben, dass der Prälat ein solches Gebet nicht ohne die Zustimmung der KPCh gewagt hätte. In der Vergangenheit hat Bischof Li Shan den Herrschern in Peking genügend Beweise für gutes Benehmen geliefert.
Andererseits ist es in der vatikanischen Diplomatie üblich, dass der Papst ein Segenstelegramm an die Staatsoberhäupter der Länder schickt, über die das Flugzeug des Papstes hinwegfliegt. Zwischen Italien und der Mongolei sind es etwa zehn Länder, die dieses Telegramm auf dem Hin- und Rückweg erhalten, darunter auch China, da der Überflug über das Land notwendig ist.
Der Pontifex konnte sich so direkt an Xi Jinping wenden, zwar in einem protokollarischen Rahmen, der jedoch an den Wunsch des Kirchenoberhaupts erinnert, eines Tages sein Flugzeug in Peking zu landen: „Zurück in Rom nach meiner Reise in die Mongolei, erneuere ich meine frommen Wünsche an Ihre Exzellenz und das Volk von China und rufe für Sie alle die Fülle des göttlichen Segens herbei.“
Der argentinische Pontifex nutzte die Messe, die er in der mongolischen Hauptstadt zelebrierte, auch, um dem chinesischen Präsidenten ein Signal des guten Willens zu senden: „Ich möchte Ihre Anwesenheit nutzen, um das edle chinesische Volk herzlich zu grüßen. (...) Und ich bitte die chinesischen Katholiken, gute Christen und gute Bürger zu sein.“
Sollen so die kommunistischen Machthaber besänftigt werden, die die „Sinisierung“ der Religionen zur Voraussetzung für ihre weitere Existenz gemacht haben?
Chinas Regierungschef Xi Jinping ließ dem Heiligen Vater jedenfalls ein Telegramm zukommen, in dem er erklärte, „das gegenseitige Vertrauen“ mit dem Vatikan „stärken zu wollen“, und urteilte, dass die Worte des Papstes „Freundschaft und guten Willen widerspiegeln.“
(Quellen: Salle de presse du Saint-Siège/Asianews – FSSPX.Actualités)
Illustration: alexandrine_chan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons