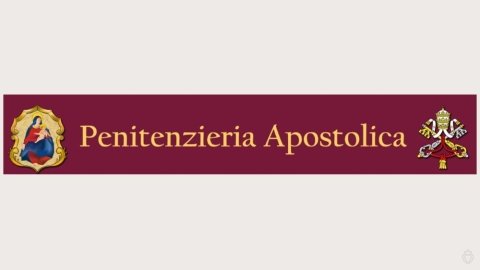„Fiducia supplicans“ und der „pastorale Segen“

Der Palast des Heiligen Offiziums, Sitz des Dikasteriums für die Glaubenslehre
„Die Kirche muss es vermeiden, ihre pastorale Praxis auf die Fixierung bestimmter doktrinärer oder disziplinarischer Schemata zu stützen.“
1. Diese Passage aus Nummer 25 der jüngsten Erklärung Fiducia supplicans ist nichts anderes als die Wiederholung des Grundprinzips, das Papst Franziskus bereits in dem postsynodalen Schreiben Amoris laetitia dargelegt hat. Dieses Prinzip findet seine Rechtfertigung in Nummer 8 der Erklärung, die sich wiederum auf Nummer 12 des Neuen Rituals bezieht, das 1985 von Johannes Paul II. erlassen wurde.
„Die Segnungen“, so heißt es dort, „können als eines der am weitesten verbreiteten und sich ständig weiterentwickelnden Sakramentale angesehen werden. Sie führen dazu, die Gegenwart Gottes in allen Ereignissen des Lebens zu erfassen und erinnern uns daran, dass der Mensch auch im Gebrauch der geschaffenen Dinge aufgefordert ist, Gott zu suchen, ihn zu lieben und ihm treu zu dienen.“
Die Segnungen sind „ständig in Bewegung“. Warum ist das so? Weil sie „erfassen“ und „erinnern“ sollen ... Erfassen und erinnern: Segenssprüche sind also nur eine Sprache, reine Zeichen, die nicht mehr und nicht weniger als eine Bewusstwerdung bewirken? Wenn dem so ist, ist es logisch, dass sie sich wie jede Sprache an die Mentalität derer anpassen, an die sie sich richten. Denn das Wichtigste in jeder Seelsorge ist es, verstanden zu werden. Daraus ergibt sich alles andere.
2. Zunächst einmal reicht es zum Segnen aus, den verschiedenen Menschen zuzuhören, „die spontan kommen und um einen Segen bitten“ (Nr. 21). Diese Bitte drückt an sich schon das Bedürfnis „nach der heilbringenden Gegenwart Gottes in ihrer Geschichte“ aus (Nr. 20).
Um einen Segen zu bitten, bedeutet, die Kirche „als Sakrament des Heils“ (ebd.) anzuerkennen, „zuzugeben, dass das Leben der Kirche aus dem Schoß der Barmherzigkeit Gottes entspringt und uns hilft, voranzukommen, besser zu leben und auf den Willen des Herrn zu antworten“ (ebd.). Kurz gesagt, die Bitte ist Ausdruck von Überzeugungen, aber was noch? Übersetzt sie einen Willen zur Heilung, einen wirksamen Vorsatz? Drückt sie den Wunsch nach einer Bekehrung aus? In Nr. 21 wird lediglich erwähnt, dass die Bittenden „sich aufrichtig der Transzendenz öffnen, ihr Herz nicht nur auf ihre eigenen Kräfte vertrauen, sich nach Gott sehnen und aus der Enge dieser in sich geschlossenen Welt ausbrechen wollen.“
Und aus der Sünde herauskommen? Offensichtlich wird das hier nicht erwähnt. Das ist nicht verwunderlich, sobald die Segnung ein Zuhören ist, denn wie jedes Zuhören muss sie sich nicht um wirksame Vorsätze kümmern. Sie geschieht in der Stunde der Hoffnung und der Erwartung.
3. Der Segen ist nicht nur ein Zuhören, er muss auch die Liebe Gottes zum Ausdruck bringen, und deshalb wird er allen ganz. Sicherlich kann er „keine Form der moralischen Legitimität für eine außereheliche Sexualpraxis bieten“ (Nr. 11). Allerdings „muss auch die Gefahr vermieden werden, die Bedeutung der Segnungen auf diesen einen Gesichtspunkt zu reduzieren, denn das würde dazu führen, dass wir für eine einfache Segnung die gleichen moralischen Bedingungen verlangen, die für den Empfang der Sakramente gefordert werden.
Diese Gefahr erfordert, dass wir diese Perspektive noch weiter ausdehnen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass eine so geliebte und verbreitete pastorale Geste an zu viele moralische Vorbedingungen geknüpft wird, die unter dem Vorwand der Kontrolle die bedingungslose Kraft der Liebe Gottes verdunkeln könnten, auf der die Geste des Segnens beruht“ (Nr. 12).
Der Segen muss also die Liebe Gottes auf differenzierte Weise zum Ausdruck bringen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht „die pastorale Liebe verlieren, die alle unsere Entscheidungen und Haltungen durchdringen muss“ und vermeiden, „uns zu Richtern zu machen, die nur ablehnen, zurückweisen und ausschließen“ (Nr. 13).
4. Das neue pastorale „Lehramt“, das von Johannes XXIII. eingeleitet wurde, versucht nicht mehr zu bekehren. Das heißt, es versucht nicht mehr, die Seelen aus der Sünde herauszuholen. Er hört zu und führt einen Dialog. Und dabei gibt er der Welt die Möglichkeit, sich als solche zu verwirklichen, indem er dem Materialismus entgeht und sich der Transzendenz öffnet.
„Im Grunde bietet der Segen den Menschen eine Möglichkeit, ihr Vertrauen in Gott zu stärken. Die Bitte um Segen drückt die Öffnung für die Transzendenz, die Frömmigkeit, die Nähe zu Gott in den tausend konkreten Lebensumständen aus und nährt sie, und das ist in der Welt, in der wir leben, nicht wenig. Es ist ein Same des Heiligen Geistes, den es zu nähren und nicht zu behindern gilt“ (Nr. 33).
Was ist mit der Sünde? Was ist mit der Bekehrung? Was ist mit der ewigen Erlösung? Kein einziges Wort. Man hat es Ihnen gesagt: Der Segen ist dazu da, Sie „die Gegenwart Gottes in allen Ereignissen des Lebens“ erfassen zu lassen.
Verwandter Artikel:
5. Deshalb „muss die Kirche vermeiden, ihre pastorale Praxis auf die Fixierung bestimmter doktrinärer oder disziplinarischer Schemata zu stützen.“ Das ist verständlich, denn Segen ist ein Aspekt der Seelsorge, und Seelsorge besteht aus Zuhören und Dialog, aus „begreifen lassen“ und „erinnern“.
In diesem Bereich sind Schemata fehl am Platz, „vor allem wenn sie zu einem narzisstischen und autoritären Elitismus führen, wo man, anstatt zu evangelisieren, andere analysiert und klassifiziert und, anstatt den Zugang zur Gnade zu erleichtern, die Energien in der Kontrolle verschleißt“ (Zitat Papst Franziskus in Nr. 25).
Daher: „Wenn Menschen sich auf einen Segen berufen, sollte eine umfassende moralische Analyse nicht als Vorbedingung für die Gewährung des Segens gestellt werden. Es sollte keine vorherige moralische Vervollkommnung von ihnen verlangt werden“ (Nr. 25). Denn es geht nicht um Bekehrung. Es geht um Dialog und Zuhören.
Das Grundprinzip dieses Zuhörens, das auch das Grundprinzip der Neuevangelisierung ist, lautet: „Wir sind für Gott wichtiger als alle Sünden, die wir begehen können, denn Er ist Vater, Er ist Mutter, Er ist reine Liebe, Er hat uns für immer gesegnet. Und Er wird nie aufhören, uns zu segnen“ (Nr. 27). Wenn wir an einem solchen Prinzip festhalten, gibt es dann überhaupt eine Hölle? Und wenn es sie gibt, wäre sie dann nicht eher leer? ... Dieses Prinzip besteht darin, „diese Menschen spüren zu lassen, dass sie trotz ihrer schweren Fehler gesegnet bleiben, dass der himmlische Vater weiterhin ihr Bestes will und darauf hofft, dass sie sich schließlich dem Guten öffnen“ (ebd.). „Sich dem Guten öffnen“: In welchem Sinne?
Ist es nur der „Wunsch, aus der Enge dieser in sich geschlossenen Welt herauszukommen“, von dem oben die Rede war? Logischerweise ja. Und deshalb erscheint die lang erwartete Schlussfolgerung unausweichlich. Auch gleichgeschlechtliche Paare haben ein Recht darauf, den Segen der Kirche zu erhalten.
6. Diese Schlussfolgerung findet sich schwarz auf weiß, wenig überraschend, in Nummer 31 der Erklärung. „Innerhalb des so umrissenen Horizonts ist es möglich, Paare mit irregulärem Status und gleichgeschlechtliche Paare zu segnen.“
Natürlich wird darauf hingewiesen, dass diese Segnung „in einer Form stattfinden wird, die von den kirchlichen Behörden nicht rituell festgelegt werden muss, um keine Verwirrung mit der Segnung zu stiften, die dem Sakrament der Ehe eigen ist.“ Und Nummer 30 übertrifft diese Vorsichtsmaßnahme, die beruhigend wirken soll, noch – man fragt sich übrigens, an wessen Adresse sie gerichtet ist: „Um jede Form von Verwirrung oder Skandal zu vermeiden: Wenn das Segensgebet, obwohl es außerhalb der in den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Riten gesprochen wird, von einem Paar mit irregulärem Status gewünscht wird, darf dieser Segen niemals zusammen mit den zivilen Riten der Eheschließung oder in Verbindung mit diesen vollzogen werden. Auch nicht mit Kleidung, Gesten oder Worten, die der Ehe eigen sind. Dasselbe gilt, wenn der Segen von einem gleichgeschlechtlichen Paar erbeten wird.“
Doch Nummer 40 beeilt sich, die von der vorherigen Nummer geschlossenen Türen wieder zu öffnen: „Eine solche Segnung kann hingegen in anderen Zusammenhängen ihren Platz finden, wie etwa beim Besuch eines Heiligtums (Lisieux?), bei der Begegnung mit einem Priester (nach der Messe?), bei einem Gebet, das in einer Gruppe gesprochen wird (anlässlich der Vesper oder des Rosenkranzes?) oder während einer Pilgerreise (Lourdes, Fatima?). Denn mit diesen Segenswünschen, die nicht nach den der Liturgie eigenen rituellen Formen gespendet werden, sondern vielmehr als Ausdruck des mütterlichen Herzens der Kirche, ähnlich jenen, die aus den Tiefen der Volksfrömmigkeit entspringen, will man nichts legitimieren, sondern nur sein Leben Gott öffnen, ihn um Hilfe bitten, um besser leben zu können, und auch den Heiligen Geist anrufen, damit die Werte des Evangeliums mit größerer Treue gelebt werden.“
Die rituellen Formen, die der Liturgie eigen sind, wären also nicht Ausdruck des mütterlichen Herzens der Kirche? Offenbar nicht, denn in Nr. 36 heißt es, dass der Versuch, aus diesen Segnungen eine liturgische Handlung zu machen, „eine schwere Verarmung darstellen würde, denn damit würde eine Geste von großem Wert in der Volksfrömmigkeit einer übermäßigen Kontrolle unterworfen, die die Amtsträger der Freiheit und Spontaneität bei der pastoralen Begleitung des Lebens der Menschen berauben würde.“
Immer diese kindische und schädliche Dialektik zwischen Autorität und Freiheit, zwischen Recht und Liebe, zwischen Gerechtigkeit und Liebe. Halten wir vorerst fest, dass diese Art der „Segnung“ innerhalb der Kirchen stattfinden kann, und, warum nicht, in der Kommunionbank, gegenüber dem Hochaltar.
Verbundener Artikel:
7. Diese Segnungen werden „auf diejenigen herabsteigen, die sich als bedürftig und auf Gottes Hilfe angewiesen erkennen und nicht die Legitimität ihres eigenen Status beanspruchen, sondern darum bitten, dass alles, was in ihrem Leben und in ihren Beziehungen wahr, gut und menschlich wertvoll ist, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes investiert, geheilt und erhöht wird“ (Nr. 31).
Es handelt sich also um eine Verbesserung, ausgehend von dem, was bereits gut ist, nicht um eine Heilung. Es wird absolut nichts über das gesagt, was falsch und schlecht ist, auch nicht menschlich gesprochen, geschweige denn über die Sünde selbst. Nichts von nichts, weder hier noch an anderer Stelle im gesamten Rest des Dokuments. Aber gibt es das überhaupt?
Wichtig ist, dass „die menschlichen Beziehungen in der Treue zur Botschaft des Evangeliums reifen und wachsen können, sich von ihren Unvollkommenheiten und Schwächen befreien und sich in der immer größeren Dimension der göttlichen Liebe ausdrücken können“ (ebd.). Unvollkommenheiten und Schwächen ... Ist das nicht zu wenig gesagt, wenn es um Ehebruch oder Homosexualität geht?
Es ist wahr, dass „die Gnade Gottes im Leben derer wirkt, die nicht behaupten, gerecht zu sein, sondern sich demütig als Sünder wie alle anderen bekennen. Sie ist in der Lage, alles nach den geheimnisvollen und unvorhersehbaren Plänen Gottes auszurichten“. Mysteriöse und unvorhersehbare Absichten, ja, die gibt es, um dem zu entsprechen, was Theologen als den göttlichen Willen „des Wohlgefallens“ bezeichnen.
Aber es gibt auch einen „gemeinten“ göttlichen Willen, der sich auf eine keineswegs geheimnisvolle, sondern vollkommen klare Weise ausdrückt und vollkommen vorhersehbaren Absichten entspricht: der Wille Gottes, wie er durch die Zehn Gebote und das Gesetz der Kirche zum Ausdruck kommt. Wäre es nicht angebracht, vor dem allseitigen Segnen diese Forderungen in Erinnerung zu rufen und mit aller Überzeugungskraft dazu zu ermahnen?
Nummer 40 beschreibt die Ambitionen dieser neuen Pastoral, „sein Leben Gott zu öffnen, ihn um Hilfe zu bitten, um besser zu leben, und auch den Heiligen Geist anzurufen, damit die Werte des Evangeliums mit größerer Treue gelebt werden“. Die Inkonsistenz solcher Ausdrücke ist zu vage, um nicht zu einer Verzögerungstaktik zu werden.
8. Die Auswirkungen dieser unheimlichen und zugleich beschämenden Erklärung werden vor allem bei den Katholiken zu spüren sein, die einmal mehr in ihren Moralvorstellungen erschüttert und regelrecht skandalisiert werden, d. h. sie werden dazu gedrängt – man könnte auch sagen: ermahnt –, das Unannehmbare nicht nur zu tolerieren, sondern zuzulassen.
Das greifbarste Ergebnis ist unmittelbar auf den Titelseiten aller Zeitungen zu sehen, die mit der Schlagzeile aufwarten, dass der Vatikan endlich (und das ist eine Premiere) die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare erlaubt.
9. Diese Erklärung ist also wirklich skandalös und der Skandal, den sie auslöst, ist groß. Wo ist die „mola asinaria“ des Evangeliums [1]? ... Aber da die Güte Gottes groß bleibt, muss in den Kirchen der Tradition zweifellos mehr Platz geschaffen werden, um – wie im Stall von Bethlehem – all die armen Katholiken aufzunehmen, die in ihrem Vertrauen immer mehr enttäuscht werden wollen...
Pater Jean-Michel Gleize, FSSPX
Pater Jean-Michel Gleize ist Professor für Apologetik, Ekklesiologie und Dogma am Priesterseminar St. Pius X. in Ecône. Er ist der Hauptbeitragsschreiber des Courrier de Rome. Er war zwischen 2009 und 2011 an den doktrinellen Diskussionen zwischen Rom und der FSSPX beteiligt.
[1] „Wenn aber jemand einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, so wäre es besser für ihn, dass man ihm einen von diesen Mühlsteinen, die ein Esel dreht, an den Hals hänge und ihn in die Tiefe des Meeres versenke“ Mt. XVIII, 6.
(Quelle: La Porte Latine – FSSPX.Actualités)
Illustration: Andre0007l, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons