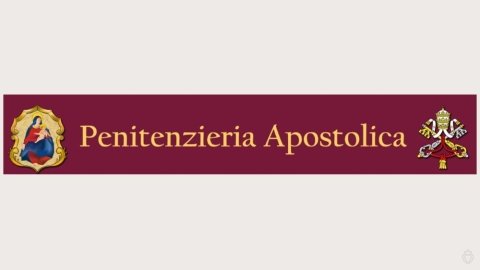Greta Thunberg: Ende der großen Heuchelei

Die jüngsten polemischen Äußerungen der Klimaschützerin zum Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgen in einigen kirchlichen Kreisen für Unbehagen, vor allem in Deutschland. Dort distanzierte sich der Episkopat von derjenigen Frau, deren Engagement er noch vor einigen Monaten in den höchsten Tönen gelobt hat.
In den progressiven katholischen Kreisen Deutschlands, die oft zu den engagiertesten Umweltschützern gehören, wurde die Schwedin Greta Thunberg seit Jahren zu einer Art Ikone erhoben. Dies ging so weit, dass allzu oft die Augen vor den gewalttätigen Positionen der jungen Aktivistin verschlossen wurden, die im Übrigen sehr oft im Widerspruch zur Lehre der Kirche standen.
Die Zeiten, in denen sich Papst Franziskus selbst mit der Klimaaktivistin traf, sind dagegen lange vorbei. Das Treffen fand im April 2019 auf dem Petersplatz statt. Im Pressesaal des Heiligen Stuhls, der in den Farben von Laudato si' beflaggt war, erklärte der Kommunikationschef damals, dass „der Heilige Vater Greta Thunberg für ihren Einsatz für die Verteidigung der Umwelt gedankt und sie ermutigt hat“.
Der Erzbischof von Krakau, Marek Jedraszewski, erklärte allerdings schon 2019, dass Greta Thunberg eine „Gefahr“ für das Christentum darstelle, er könne die Begeisterung nicht teilen.
Inzwischen sind vier Jahre vergangen und die Realitäten sind ans Tageslicht gekommen. Seit dem 7. Oktober 2023 ist die junge Aktivistin tatsächlich nicht mehr in der Lage, die von der islamistischen Organisation Hamas in Israel begangenen Übergriffe anzuprangern. Schlimmer noch, sie instrumentalisiert ihre ökologischen Angriffe, um feindselige Slogans gegen den hebräischen Staat zu verbreiten, wobei sie nicht zögert, zweideutige Symbole zu tragen, die manche als antisemitisch anprangern.
Eine Meinungsumfrage, die das Institut INSA Consulere vom 17. bis 20. Oktober in Deutschland durchführte, ergab, dass Greta Thunberg weder bei den Katholiken noch bei den Protestanten auf Zustimmung stößt.
Zum selben Thema:
Die entlarvende Kehrtwende des deutschen Episkopats
In diesem Zusammenhang kommt die Kehrtwende des deutschen Episkopats nicht überraschend, aber sie lässt einen dennoch schmunzeln. So distanzierte sich im November 2023 der Sprecher der Diözese Hildesheim (Niedersachsen) „von den aktuellen Äußerungen Greta Thunbergs zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten, da diese einseitig sind und der Komplexität der Situation im Heiligen Land in keiner Weise gerecht werden.“
Zur Erinnerung: 2019 sah der Ortsbischof Heiner Wilmer, der Eugen Drewermann, der 2005 wegen seiner antikatholischen Haltung aus der Kirche ausgetreten war, als Propheten ansieht und für den Text des Synodenwegs zur Reform des katholischen Moralunterrichts stimmte, in der jungen schwedischen Aktivistin eine „Prophetin“ der Neuzeit.
Der Erzbischof der bundesdeutschen Hauptstadt, Heiner Koch, beeilte sich, der Presse zu erklären, dass er „auf der Seite unserer jüdischen Brüder“ stehe.
Derselbe Prälat hatte – ebenfalls im Jahr 2019 – den Aktivismus der Schwedin „mit der biblischen Szene des Einzugs Jesu in Jerusalem“ verglichen. Eine Weitsicht, die den Internetnutzern jedenfalls nicht entgangen ist: „Na, wie geht es Ihnen @ErzbischofKoch“, war vor einigen Tagen auf der Plattform X (Twitter) zu lesen.
Von dem französischen Schriftsteller Charles Pierre Péguy stammt der schöne Satz zur Wahrhaftigkeit: „Man muss immer sagen, was man sieht: vor allem muss man immer, was schwieriger ist, wirklich sehen, was man sieht.“ Eine Überlegung, die in der Ökologie wie in der Theologie, an den Ufern des Rheins wie an den Ufern des Tibers ihre Gültigkeit hat.
(Quellen: Die Tagepost/Katolisch.de/Wikipédia – FSSPX.Actualités)
Illustration: Photo 144229061 © James Rea | Dreamstime.com