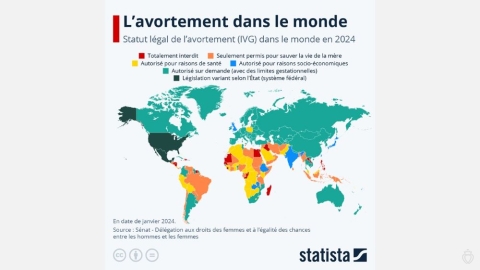Das Dikasterium für die Glaubenslehre zu LGBT-Fragen

Das Dikasterium für die Glaubenslehre (Dicasterium pro doctrina fidei, DDF), dessen Vorsitzender nun Kardinal Victor Manuel Fernandez ist, hat eine Antwort an Bischof José Negri von Santo Amaro in Brasilien veröffentlicht, die sich mit einigen „Fragen bezüglich der möglichen Teilnahme von Transsexuellen und homoaffinen Personen an den Sakramenten der Taufe und der Ehe“ befasst.
Die Antwort wurde von Papst Franziskus bei einer Audienz am 31. Oktober unterzeichnet. Sie enthält sechs Fragen, die sich auf die Möglichkeit der Taufe von Transgendern, ihre Zulässigkeit als Paten bei einer Taufe oder als Zeugen bei einer Hochzeit beziehen. Danach folgt der Fall von Homosexuellen: Taufe eines Adoptivkindes, Patenschaft und die Möglichkeit, Trauzeuge bei einer Hochzeit zu sein.
Vorläufige Erwägungen
Diese Antworten sind durch eine eklatante Inhaltslücke gekennzeichnet, nämlich die Frage nach der begangenen Sünde, die Situation der Sünde und das Verharren in einem Zustand ohne Reue. Der Begriff des Skandals wird erwähnt, aber die objektive Situation der Personen mit den Konsequenzen, die sich daraus für die Möglichkeit ergeben, ein christliches Leben zu führen, oder um ein Beispiel zu geben, wird vernachlässigt.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass der reformierte Kodex des kanonischen Rechts von 1983 den Begriff des „öffentlichen Sünders“ und die damit verbundene rechtliche Konnotation der „Infamie“ aufgegeben hat. Im Kodex des kanonischen Rechts von 1917, der von Papst Pius X. ausgearbeitet wurde, führte die Infamie zur Unmöglichkeit der Patenschaft.
Der Schlüsselsatz, der die gesamte Reflexion der Antwort steuert, stammt aus der Enzyklika Evangelii gaudium: „Die Türen der Sakramente sollten nicht aus irgendeinem Grund geschlossen werden. Dies gilt vor allem für jenes Sakrament, das „die Tür“ ist, die Taufe. (...) Die Kirche ist kein Zollamt, sie ist das Vaterhaus, wo es Platz für jeden mit seinem schwierigen Leben gibt.“
Trotz einiger sprachlicher Manöver offenbart sich tatsächlich die Haltung, die im fünften Dubium der fünf Kardinäle, das im Juli an den Papst geschickt wurde, angeprangert wird und die sich auf die Notwendigkeit der Reue bezieht, um die Absolution zu erhalten. Hier geht es um die Taufe und die Ehe, aber die Grundlage bleibt die gleiche.
Die ersten drei Antworten zu Transsexuellen
Die erste Frage lautete: „Kann ein Transsexueller getauft werden?§. Die lange Antwort beginnt mit einem „Ja“, allerdings mit der Bitte, einen öffentlichen Skandal oder die Verwirrung der Gläubigen zu vermeiden. Doch nachdem Franziskus zitiert wird (Evangelium gaudii), verwässert sich alles weitere und die Taufmöglichkeit wird bestätigt, auch wenn „die Änderungsabsicht nicht voll zum Ausdruck kommt“.
Die Frage ist: Lebt der Taufbewerber in Übereinstimmung mit dem Glauben und hat er die feste Absicht, die in der Transsexualität enthaltene Sünde aufzugeben? Diese Absicht muss durch Taten bestätigt werden. Wenn die Person nicht operiert wurde und/oder sich keiner Behandlung unterzieht, ist sie dann bereit, sich zu verpflichten, diese nicht in Anspruch zu nehmen? Und, wenn sie sich einer Operation unterzogen hat, besteht echte Reue? Ohne diese feste Absicht ist es nicht möglich, die Taufe zu spenden. Die Antwort des DDF ertränkt die Sünde unter dem Zweifel an der objektiven moralischen Situation der Person oder an der Ungewissheit ihrer subjektiven Dispositionen und meint, dass die Zukunft unvorhersehbar sei und man eine Chance geben müsse.
Die zweite Frage lautete: „Kann ein Transsexueller bei einer Taufe Pate oder Patin sein?“. Die Antwort lautet ja, auch wenn eine Hormonbehandlung und eine chirurgische Behandlung stattgefunden haben. Aber, so räumt sie ein, da es kein Recht ist, Pate zu sein, sollte man darauf verzichten, wenn die Gefahr eines Skandals, einer unzulässigen Legitimation oder einer Desorientierung der kirchlichen Gemeinschaft besteht.
Wenn die Situation des Transsexuellen öffentlich ist, muss nach dem Codex des kanonischen Rechts von 1917 die Patenschaft verweigert werden. Denn ein Erwachsener, der sein Geschlecht ändert, begeht aus freien Stücken eine schwere Sünde und wird als öffentlicher Sünder betrachtet, womit die Frage geklärt wäre. Wenn es sich um eine okkulte Situation handelt, könnte die Antwort anders ausfallen, aber die pastorale Beurteilung muss vorsichtig sein, und die aktuelle Situation ermutigt nicht zur Annahme.
Die dritte Frage schließlich war: „Kann ein Transsexueller Trauzeuge bei einer Hochzeit sein?“. Die Situation ist hier anders als bei der Taufe, da die einzige Voraussetzung für einen Trauzeugen die Fähigkeit zu diesem Amt ist. Die Antwort lautet: „Nichts im gegenwärtigen universellen kanonischen Glauben verbietet es einer transsexuellen Person, Trauzeuge bei einer Eheschließung zu sein.“
Diese Antwort ist jedoch zu kurz gegriffen. Nach kirchlichem Recht ist das richtig. Aber vom natürlichen und göttlichen Recht her muss man den Skandal berücksichtigen. Es muss also erneut zwischen der öffentlichen Situation und dem verdeckten Fall unterschieden werden. Im ersten Fall scheint es schwierig zu sein, einen Skandal zu vermeiden, im zweiten Fall wird die Sache nach pastoraler Klugheit abzuwägen sein.
Die drei Antworten zu Homosexuellen
Die vierte Frage betrifft die Taufe von Kindern eines gleichgeschlechtlichen Paares: „Kann das Kind von zwei homosexuellen Personen, unabhängig davon, ob es adoptiert oder durch eine andere Methode wie Leihmutterschaft erhalten wurde, getauft werden?“. Die Antwort lautet ja, „wenn es eine begründete Hoffnung gibt, dass es in der katholischen Religion erzogen wird.“
Es ist klar, dass man die Taufe eines jeden Kindes nur wünschen kann, wenn die gegebene Bedingung erfüllt ist. Die Situation gibt jedoch nicht wirklich Anlass zur Hoffnung, dass dies der Fall sein könnte. Wie kann ein Kind, das unter den Bedingungen eines solchen Haushalts aufwächst, der Ansteckung durch Manieren, Ideen oder Sünde, die durch dieses Zusammenleben vermittelt werden, entgehen?
Die Situation unterscheidet sich deutlich von der geschieden-wiederverheirateter Menschen, bei denen die Natur im Wesentlichen respektiert wird. Abgesehen von extremen Sonderfällen scheint es daher nicht möglich zu sein, ein Kind unter diesen Umständen zu taufen.
Die fünfte Frage lautete: „Kann eine homosexuelle Person, die in einer „Wohngemeinschaft“ lebt, zur Patenschaft zugelassen werden?“. Die Antwort lautet ja, wenn sie „ein Leben führt, das dem Glauben und der Aufgabe, die sie übernimmt, entspricht.“ Wenn dieses Zusammenleben jedoch eindeutig und öffentlich ein „eheliches“ Leben ist, wird die klare Antwort vermieden, um die Sache schließlich doch der Vorsicht des Pastors zu überlassen.
Die Frage liegt letztlich darin, ob die Sünde verborgen oder öffentlich ist. Im ersten Fall steht die Möglichkeit tatsächlich der Vorsicht des Pastors offen. Im zweiten Fall ist jedoch die Situation einer „öffentlichen Sünde“ gegeben, und die Patenschaft muss abgelehnt werden.
Die sechste Frage lautete, ob „eine homosexuelle Person, die in einer „Wohngemeinschaft“ lebt, Trauzeuge sein kann?“. Die Antwort des DDF ist die gleiche wie bei einem Transsexuellen. Was die katholische Antwort angeht, so muss man das wiederholen, was zuvor über die Unterscheidung zwischen öffentlicher und verdeckter Situation gesagt wurde: Im ersten Fall würde es einen Skandal geben, im zweiten Fall eine offene Möglichkeit.
Schlussfolgerung
Die gegebenen Antworten gehen genau in die Richtung, die Papst Franziskus seit Amoris laetitia im Bereich der Moral vorgibt. Es handelt sich um eine allmähliche Verschiebung der Maßstäbe, langsam genug, um das Gewissen nicht zu alarmieren, mit dem Ziel, der Kirche ein neues Verständnis von Moral und der Kirche selbst aufzuzwingen. Aber wie weit will und wird der Papst gehen? Weiß er es das überhaupt selbst? Das scheint nicht sicher. Dennoch hat er einen fatalen Prozess in Gang gesetzt, der Gläubige und sogar Pastoren über die Grenzen der katholischen Doktrin hinausführen wird...
(Quellen: Vatican news – FSSPX.Actualités)