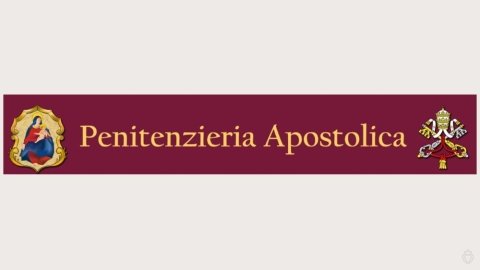Im Gaza-Streifen stößt das Pontifikat an seine Grenzen

Das Treffen von Papst Franziskus mit israelischen und palästinensischen Delegationen am 22. November 2023 führte zu Kontroversen, da führende Vertreter des Judentums in Italien die Haltung des römischen Pontifex als eine Art Relativierung der Tragweite der Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober anprangerten. Darüber hinaus wird die gesamte Regierungsführung des derzeitigen Pontifikats in Frage gestellt.
Die Polemik, die durch von der palästinensischen Seite berichtete Äußerungen des Pontifex verursacht wurde, wirft die Frage auf, inwieweit das Staatssekretariat und die Diplomaten des Heiligen Stuhls in die Organisation der Audienz am 22. November 2023 eingebunden waren. Eine wichtige Frage: Die Koordination zwischen dem Nachfolger Petri und seinen diplomatischen Diensten bleibt unbeachtet.
Der Religionshistoriker Massimo Faggioli, Professor am Studiendepartment für Theologie und religiöse Studien der Villanova-Universität in Philadelphia (USA) und Autor mehrerer Bücher über den Katholizismus, meint dazu: „In der Beziehung zum Judentum und zum Islam kann man sich nicht auf Szenarien aus der Vergangenheit stützen oder improvisieren. Wir brauchen einen Pontifex, der weniger großzügig mit Worten umgeht, sondern mehr überlegt und aufmerksam ist.“
Ein Pontifex, der insbesondere darauf bedacht ist, den diplomatischen Diensten des Heiligen Stuhls, die mit den komplexesten internationalen Situationen vertraut sind, Gehör zu schenken, während allerdings seit 2013 eine allmähliche Marginalisierung des Staatssekretariats stattgefunden hat.
Die Ereignisse vom 7. Oktober eröffnen eine besonders heikle Sequenz, die die Situation im Dialog mit dem Judentum und dem Islam so verändern kann, dass die sehr „persönliche“ Führung von Papst Franziskus in Frage gestellt wird: Laut dem italienischen Historiker „gibt es Grenzen und Konsequenzen für ein Pontifikat, wenn man diese Dinge auf einer sehr persönlichen Ebene behandelt. Dies stellt aus meiner Sicht eine Grenze dar. Es ist ein Stil, der mit anderen Arten von Gesprächspartnern funktionieren kann, aber hier gibt es meiner Meinung nach Grenzen und auch einen Preis in Form von Missverständnissen und Spannungen, die besser vermieden werden sollten. (...) Eine Sache ist es, mit Entitäten des internationalen Rechts zu verhandeln, eine andere, sich an eine Diözese, ein Kloster oder eine kirchliche Bewegung zu wenden.“
Ein isolierter und in der Kritik stehender Papst
Daher das derzeitige Bild eines besonders einsamen Papstes, der in vielen Angelegenheiten an vorderster Front erscheint und sich dadurch direkt ins Kreuzfeuer der manchmal heftigen und ungefilterten Kritik an seiner Person begibt. In der jüngsten Vergangenheit gab es viele Beispiele, die das Prestige des Papstamtes untergraben haben.
Dies stellt auch Massimo Faggioli, sonst einer der wichtigen Apologeten der aktuellen Papstpolitik in den Medien, fest: „Ich glaube, dass Franziskus auf eine isoliertere Art und Weise regiert als seine Vorgänger. Zu deren Zeiten gab es die „päpstliche Wohnung“, mit einem sichtbaren und identifizierbaren Sekretär, der eine Filterfunktion hatte. Das ist verschwunden: Heute hat der Sekretär des Papstes eine Funktion mit variabler Geometrie, die nicht sichtbar ist. Und die Rolle der Römischen Kurie bleibt auch unter dem derzeitigen Pontifikat unklar.“
Die 2022 verkündete Reform der Römischen Kurie hat das Amt des Staatssekretärs einzigartig geschwächt und die Kurie wieder auf den Papst ausgerichtet. Diese Dimension wurde durch die Verkündung des Grundgesetzes der Vatikanstadt im Mai letzten Jahres bestätigt. Zwei widersprüchliche Imperative stehen sich gegenüber: Einerseits muss die Kirche „ausgehen“, indem sie „synodal“ wird, andererseits muss sie auf die Person des Papstes selbst zentriert bleiben, der nicht zögert, in aller „Vertikalität“ allein zu entscheiden.
„Dies ist eine der Auswirkungen einer Ekklesiologie, nach der die Kirche ein Volk ist, mit dem der Papst in direkter Beziehung steht“, so Massimo Faggioli als Arbeitshypothese. Eine Form des „kirchlichen Peronismus“, könnte man hinzufügen.
Um die zehn Jahre des aktuellen Pontifikats in aller Kürze zusammenzufassen, könnte man Massimo Faggioli weiter zitieren: „Meine These zu diesem Pontifikat ist, dass es eine Phase der sehr starken Beschleunigung in Richtung Globalisierung des Katholizismus darstellt. (...) Es ist ein globalerer Katholizismus, weniger europäisch, multikultureller, vielfältiger, aber auch schwieriger zusammenzuhalten. (...) Es ist ein historischer Moment, denn die Kirche verändert ihr Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes.“ All dies auf die Gefahr hin, dass sie aus diesem Facelifting der neuen Art entstellt hervorgeht.
(Quelle: Huffington Post – FSSPX.Actualités)
Illustration: Photo 62794135 © Michal Bednarek | Dreamstime.com