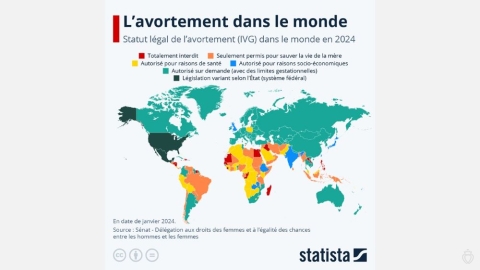Papst Franziskus macht Personalpolitik unter Hochdruck

Am 9. Juli 2023 kündigte Papst Franziskus an, dass er am 30. September im Rahmen eines Konsistoriums 21 Kardinäle kreieren werde. Es ist keine Notwendigkeit, die den Pontifex zu dieser Maßnahme veranlasst, denn nach den von Johannes Paul II. festgelegten Regeln liegt die Höchstzahl der Wähler im Konklave bei 120 Kardinälen.
Nach dem Konsistorium im September wird das Kardinalskollegium 137 Wähler umfassen, davon 53 Europäer, 24 Asiaten, 19 Afrikaner und 17 aus Nordamerika. 16 werden aus Südamerika, fünf aus Mittelamerika und drei aus Ozeanien kommen. Insgesamt werden 99 von Franziskus kreiert worden sein, was mehr als 70 Prozent der Kardinäle unter 80 Jahren ausmacht. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 hat Papst Franziskus in acht Konsistorien 121 Kardinäle aus 66 Ländern kreiert. Erst 2024/2025 wird die Höchstzahl der Wähler wieder unter 120 liegen.
Die Getreuen von Franziskus
Die große Zahl neuer Kardinäle zeigt deutlich, dass Franziskus glaubt, dass ihm die Zeit davonläuft. Er will mit seiner Personalpolitik sicherstellen, dass der mit ihm begonnene Reformprozess auch nach ihm fortgesetzt werden kann. Aus diesem Grund besteht die Liste der zukünftigen Kardinäle aus Männern seines Vertrauens, die seinen reformorientierten Ideen sehr nahe stehen. So finden sich folgende Namen:
Victor Manuel Fernández, der gerade zum Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre (Argentinien) ernannt wurde; Grzegorz Ryś, Erzbischof von Lodz (Polen), einer der wenigen polnischen Prälaten, die die Linie des Papstes unterstützen; Stephen Chow Sau-yan, S.J., Bischof von Hongkong (China), dessen Dialogbereitschaft mit Peking Franziskus schätzt; Angel Sixto Rossi, ebenfalls Jesuit, Erzbischof von Córdoba (Argentinien), der sich sehr sozial engagiert; Américo Manuel Alves Aguiar, Weihbischof von Lissabon (Portugal), der am 6. Juli gegenüber RPT Noticias erklärte, dass er nicht versuche, die Jugendlichen auf dem Weltjugendtag (WJT) vom 1. bis 6. August zu Christus zu bekehren.
Auf katholisches.info vom 9. Juli schreibt der Vatikanist Giuseppe Nardi hellsichtig: „Die ersten Tage der Sommerferien der römischen Kurie waren von zwei radikalen Veränderungen geprägt: der Auflösung der Kongregation für die Glaubenslehre [mit der Ernennung von Erzbischof Fernández zu ihrem Leiter] und einer Verbissenheit, bergoglianische Mehrheiten für die Zeit nach Franziskus zu sichern.“
Jean-Marie Guénois, der Religionsberichterstatter von Le Figaro, teilte diese Ansicht und schrieb am 9. Juli: „Kein römischer Pontifex vor Franziskus hat es sich jemals erlaubt, so schnell neue Kardinäle zu schaffen – fast eine Beförderung pro Jahr – um die Nachhaltigkeit seiner Reformen zu gewährleisten. [Zur Erinnerung: Johannes Paul II. berief in 25 Jahren neun Konsistorien ein].“ Er erklärte weiter: „Für Franziskus ist die Ernennung von Kardinälen, die seiner Linie nahe stehen, eine entscheidende Dimension seiner Politik der Kirchenreform, da sie die Wahl der Linie seines Nachfolgers bestimmt. Er lehnt damit jede abweichende Persönlichkeit ab, was seine Vorgänger nicht taten, die stets Kardinäle aufnahmen, die ihnen ablehnend gegenüberstanden, um der Meinungsvielfalt in der Kirche Rechnung zu tragen.“
Das Erbe schnell sichern, doch welches Erbe?
Andrea Gagliarducci kommentierte auf der Website Monday Vatican vom 11. Juli, dass Franziskus zwar alles tue, um sein Erbe zu sichern, dass es sich aber um ein „unsicheres Erbe“ handele. „Der Papst zeigt schließlich, dass er kein Vertrauen in seine Revolution und ihre Auswirkungen hat. Er weiß, dass er nicht die Herzen aller Menschen erobert hat. Dieses Pontifikat war durch die Präsenz von „Revolutionswächtern“ gekennzeichnet, die in der Lage sind, jede kritische Position als „antipapistisch“ zu bezeichnen, selbst wenn diese Kritik relativ moderat war und nur Fragen aufwarf, anstatt die Autorität des Papstes in Frage zu stellen.“
Am 17. Juli, ebenfalls auf Monday Vatican, fragt sich der italienische Vatikanist, was von diesem Erbe, das Franziskus so hartnäckig und überstürzt in Sicherheit zu bringen versucht, übrig bleiben wird. Natürlich, wie bereits erwähnt, „haben die neuen Kardinäle des Papstes ein niedriges Durchschnittsalter; die neuen Erzbischöfe von Madrid, Brüssel und Buenos Aires sind um die 60 Jahre alt und haben somit mindestens 20 Jahre Leben vor sich.“ So dass „Franziskus also nicht nur neue Bischöfe und Kardinäle ernannt hat, sondern sie seinem Nachfolger in gewisser Weise aufgezwungen hat.“ Dann berichtet Andrea Gagliarducci von einem vertraulichen Gespräch: „Vor einiger Zeit erzählte mir ein enger Vertrauter von Franziskus, dass der Papst einen Zehnjahresplan habe. Wenn ich all die Initiativen sehe, die in den letzten Monaten ergriffen wurden, erscheint mir das wie eine lebendige Prophezeiung. Warum zehn Jahre? Weil in zehn Jahren alle, die seinen Plan hätten blockieren oder zumindest die Mängel seiner Reformen hätten aufzeigen können, die römische Kurie verlassen hätten.“
Die zentrale Frage bleibt jedoch: Was hat Papst Franziskus hinterlassen? Andrea Gagliarducci: „Vielleicht ist sein unglaublichstes Vermächtnis seine Medienpräsenz, das Bedürfnis, öffentlich über Dinge zu sprechen, die in der Vergangenheit tabu gewesen wären, wie der Missbrauchsskandal in der Kirche, und sogar so weit zu gehen, die Institution selbst in einer Kommunikationskampagne anzuklagen, die den Papst zu verherrlichen und alles andere in Schwierigkeiten zu bringen scheint.“
Zur Idee einer „systemischen“ und nicht „konjunkturellen“ Korruption, die eine umfassende Reform der Kirche rechtfertigen würde, indem sie von ihrem angeblichen tridentinischen „Klerikalismus“ befreit wird, meint Andrea Gagliarducci: „In seinen Missbrauchsvorwürfen nimmt der Papst ein Kreuz auf, das Johannes Paul II. getragen hatte. Unter Johannes Paul II. waren Skandale in der Kirche zum ersten Mal aufgedeckt worden. Aber Johannes Paul II. und Benedikt XVI. haben trotz der Bitte um Entschuldigung nie die Institution angeklagt, da der Unterschied zwischen individueller und institutioneller Verantwortung für sie offensichtlich blieb. [...] Papst Franziskus hat eine neue Saison eingeleitet: die einer Kirche, die der öffentlichen Meinung zuhört, die sich von der öffentlichen Meinung herausfordern lässt und die antwortet, ohne interne Konsequenzen zu fürchten. Der Missbrauchsfall in Chile, den Papst Franziskus erst nach den im Land eingegangenen Protesten im Jahr 2018 vertiefte, ist emblematisch. [...]
Der öffentlichen Meinung nachzugeben – was der Papst als „Altar der Heuchelei“ bezeichnete [beim Rücktritt des Erzbischofs von Paris, Michel Aupetit, im Dezember 2021] – bedeutet, Terrain abzutreten, den Medien die Initiative zu überlassen. Dennoch ist diese erneuerte (und manchmal naive) Transparenz vielleicht das wichtigste Vermächtnis von Papst Franziskus. Es gibt kein Zurück in dieser manchmal heiklen Beziehung zu den Medien. Wenn die Tür einmal geöffnet ist, bleibt sie offen.“
Dem italienischen Journalisten zufolge ist das Erbe von Franziskus eine Kirche, die auf die öffentliche Meinung hört und sich ihr unterwirft. Damit hat sie sich dem Zeitgeist geöffnet. Es ist also sicherlich nicht die Kirche Mater et magistra – die Mutter, die die geoffenbarte Wahrheit lehrt, die sie als Depositum erhalten hat.
(Quellen: katholisches.info/Le Figaro/Monday Vatican – Trad. à partir de benoitetmoi/DICI n°435 – FSSPX.Actualités)
Illustration: Photo 29258472 © Rostislav Glinsky | Dreamstime.com