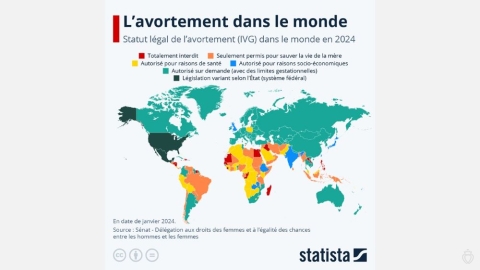Die Ermahnung „Laudate Deum“ ist kein großer geistiger Wurf

Als Papst Franziskus am 4. Oktober 2023, dem Fest des Heiligen Franziskus von Assisi, sein zukünftiges Apostolisches Schreiben ankündigte, beschrieb er es als „einen zweiten Teil von Laudato si', um die aktuellen Probleme zu aktualisieren.“ Um diesen neuen Text über die Ökologie zu beurteilen, muss man Laudato si', dessen Fortsetzung er sein soll, erneut aufgreifen und bewerten.
Die Enzyklika Laudato si' als Feststellung eines universellen Versagens
Der Text stellt „ein allgemeines politisches Versagen“ fest. Der Papst kommt zu dem Schluss, dass das derzeitige politische System aufgrund der Dominanz der wirtschaftlichen Dimension über die Politik veraltet ist. Der Papst zielt auf die Profitgier, eine Verzerrung der Wirtschaft, sowie auf den Konsumismus ab.
Die Enzyklika prangert die Technik als neuen Götzen an. Der Papst greift dieses Thema häufig auf. Er spricht von der „Globalisierung des technokratischen Paradigmas“. Der Papst sieht die Ursachen im Anthropozentrismus, der die Technik über die Realität stellt, und im Skeptizismus, der die Wahrheit abschafft.
Eine von einer bestimmten Weltanschauung geleitete Kritik
Der Standpunkt der Enzyklika verweist auf das rein Natürliche. Die zugrundeliegende Analyse ist sozial-ökologisch inspiriert. Sie begnügt sich damit, die Gier der Menschen festzustellen, vergisst aber, den Grund dafür zu nennen, der theologischer Natur ist: die Wunden der Erbsünde, speziell das maßlose Verlangen nach Reichtum.
Der Text vermischt befreiungstheologische mit ökologischen Ansätzen und verfällt dabei mehr oder weniger genau dem Irrtum, den er anprangern will. Der grüne Szientismus wird zum vorherrschenden Denken, wobei die theologische Ursache außer Acht gelassen wird: Christus nicht zu erwähnen, bedeutet, auf der Ebene des Relativismus zu bleiben.
Das Konzept der Ökologie nach Franziskus
Das päpstliche Konzept der Ökologie tangiert das, was die Philosophie als praktische Wissenschaften charakterisiert, die Technik das Handeln, den Bereich der Moral. Es ist also der Versuch einer Synthese der Humanwissenschaften: Politik, Kultur, Soziologie, Wirtschaft, Finanzen, Ökologie. Das erinnert an die Synthese von Auguste Comte (1798-1857), dem Begründer des Positivismus, der in der Soziologie die Krönung des gesamten menschlichen Wissens sah. In ähnlicher Weise wäre es für Franziskus die integrale Ökologie, die die Krönung aller Sozialwissenschaften wäre.
Die ökologische Katastrophe und ihre Ursachen
Die Anklage der „großen Verschlechterung unseres gemeinsamen Hauses“ nimmt den größten Teil der Enzyklika ein. Die Enzyklika listet die ökologischen Schäden auf und erläutert deren Ursachen. Nach einem „ökologischen Handbuch“ wird die politische Ursache im Nord-Süd-Gegensatz verortet. Die letztendlichen Ursachen der Krise liegen in der Globalisierung des technokratischen Paradigmas, der Hegemonie der Wirtschaft und dem Anthropozentrismus.
Abhilfemaßnahmen für die gegenwärtige Situation
Der Papst empfiehlt die Einrichtung einer „echten politischen Weltautorität“, die dem Beispiel von Johannes XXIII. und Benedikt XVI. folgt. Er fordert auch tiefgreifende soziale Veränderungen, um zu ökologischem Respekt zu erziehen, sowie individuelle Veränderungen, deren Vorbild die Erd-Charta ist – ein oberflächlicher Text, der mit Phrasen durchsetzt ist.
Die ökologische Utopie von Papst Franziskus
Die päpstliche Lehre weist alle Merkmale einer umfassenden „ökologischen“ Utopie auf. Und zwar über die emotionale Dringlichkeit, mit der sie verkündet wird, durch die zur Schau gestellte Universalität. Es geht darum, alle politischen, wirtschaftlichen und technologischen, aber auch anthropologischen, erzieherischen, philosophischen und spirituellen Prozesse völlig neu zu gestalten! Ein echter Reset …
Der tiefere Grund, warum der Papst eine Utopie verfolgt, liegt in seiner Zukunftsvision begründet: Der Anspruch, eine gerechte Welt „für morgen“ zu verwirklichen, beruht auf einer liberal und freimaurerisch inspirierten Illusion des „sozialistischen“ Typs. Es ist eine Ablehnung des Königtums Christi und seiner Gnade, sei es implizit oder konzeptuell.
Eine millenaristische und pelagianische Utopie
Es muss daran erinnert werden, dass unser Herr Jesus Christus sein Königreich nie als Wiederherstellung der edenischen Glückseligkeit, die an das irdische Paradies – den Garten Eden – erinnert, dargestellt hat. Eine solche Sichtweise steht im Gegensatz zum Evangelium und setzt eine Art Millenarismus voraus.
Was die persönliche Ebene betrifft, so wird die Teilnahme am Gemeinwohl als Akt der Nächstenliebe und als „intensive spirituelle Erfahrung“ dargestellt. Es bedarf eines individuellen Fortschritts, persönlicher und sozialer Tugenden, die wie eine Rückkehr zur ursprünglichen Gerechtigkeit klingen.
Dies ist in der Tat die schwerwiegendste Utopie: ein charakterisierter und unausrottbarer Pelagianismus. Wir wissen, mit Pelagianismus ist die Lehre des Mönchs Pelagius (350-420) gemeint, der behauptete, dass es möglich sei, das göttliche Gesetz ohne die Hilfe der Gnade zu befolgen. Er wurde von Augustinus bekämpft und von Papst Zosimus verurteilt. Auch die allgemeine „Bekehrung“, die Franziskus anstrebt, wird ohne die Hilfe Gottes konzipiert. Wie kann man sich eine „Zivilisation der Liebe“, eine „universelle Brüderlichkeit“ oder eine „neue Synthese“ ohne die Gnade vorstellen? Das bedeutet, das universale Königtum Christi zu vergessen und zu verachten, der allein in der Lage ist, den verwundeten Menschen wiederherzustellen.
Die Ermahnung Laudate Deum
Dieser neue Text dreht sich fast ausschließlich um die Klimakrise, wie es auch sein Untertitel ankündigt. Diese Sorge wird jedoch geradezu zur Obsession. Es handelt sich um einen regelrechten „Klimakurs“, in dem es um Temperatur, Klimawandel, die vehemente Verteidigung der Ursache der Erwärmung und die Anklage gegen diejenigen, die sie leugnen würden, geht. Franziskus behauptet, die Ursache für den Wandel sei anthropogen, also vom Menschen verursacht. Der Papst lässt sich ausführlich über Treibhausgase aus und garniert dies mit einer weiteren Anklage gegen die Kritiker. Es folgen die gelisteten Schäden an Gletschern, Eisschollen, Meeresströmungen und so weiter – insgesamt macht dies fast ein Drittel des Dokuments aus.
Im nächsten Schritt greift Franziskus die Frage nach dem „technokratischen Paradigma“ und der Notwendigkeit auf, die menschliche Macht und ihre Grenzen zu überdenken. Dies führt zur Feststellung der Schwäche der internationalen Politik und der Notwendigkeit, „einen neuen Prozess der Entscheidungsfindung und -legitimation“ einzuleiten, da das, was bereits eingeführt wurde, unzureichend ist. Der Papst geht dann auf die Klimakonferenzen (COPs), ihre Teilerfolge und Misserfolge ein. Er muss feststellen, dass „die Abkommen nur wenig umgesetzt wurden, weil kein angemessener Mechanismus zur Überwachung, regelmäßigen Überprüfung und Bestrafung bei Nichteinhaltung eingerichtet wurde.“ Bezüglich der COP 28 in Dubai, bleibt Franziskus – was das zu erwartende Ergebnis angeht – skeptisch.
Das Dokument schließt mit sehr dürftigen „spirituellen Motivationen“. Franziskus betont am Ende vor allem die Notwendigkeit, gemeinsam zu gehen, und den zu fördernden kulturellen Wandel, der eine neue globale Haltung ermöglichen soll.
Der Text insgesamt wiederholt in eklatanter Weise die Defizite von Laudato si'. Erstens eine Lehre außerhalb des Bereichs des Lehramts, denn das Klima ist nicht wirklich Teil des Feldes der göttlichen Offenbarung. Zweitens ist die Tatsache, dass man sich auf diese Weise in einem Bereich ausbreitet, in dem man nur die Kompetenz derer hat, die einem geholfen haben, erbärmlich und wird nur sehr geringe Auswirkungen haben. Schließlich und vor allem muss der Papst, wenn er den Planeten retten will, damit beginnen, Jesus Christus zu predigen, der die einzige Lösung ist. Die Tugend, insbesondere die Gerechtigkeit und die Klugheit, gehören dem, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ohne diese göttliche Gnade, die uns für die Ewigkeit rettet und uns hier auf Erden führt, gibt es nichts oder nicht viel.
Related links
(Quelle: Vatican.va – FSSPX.Actualités)