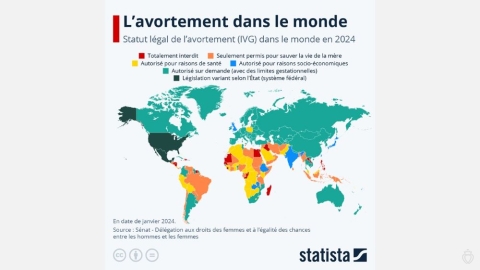Presseauswertung zum „Instrumentum laboris“ der Synode über die Synodalität (1)

Am 20. Juni 2023 veröffentlichte der Vatikan das Arbeitsdokument (Instrumentum laboris), das als Grundlage für die Arbeit der Synode über die Synodalität im Oktober dienen wird. Am 21. Juni schrieb der Vatikanist des Figaro, Jean-Marie Guénois, dass diese Synode „die Hierarchie der Macht in der Kirche zugunsten der gläubigen Laien, darunter Frauen, umkehren will. Selten hat sich die katholische Kirche so sehr in Frage gestellt.“
Tatsächlich stellte der französische Journalist fest, dass das Programm Überlegungen zu folgenden Themen vorsieht: „Priesterweihe verheirateter Männer und Diakonenweihe von Frauen“, Bischöfe, die „regelmäßig in ihrem Amt bewertet und [denen] gegebenenfalls widersprochen werden sollte, in ihrer Amtsausübung“, und schließlich „Zusammenschlüsse von Ortskirchen in großen Regionen der Welt [die] bei wichtigen Entscheidungen genauso viel Gewicht haben können wie Rom“.
Jean-Marie Guénois ist der Ansicht, dass „es Franziskus darum geht, die verheerenden Auswirkungen der Krise des sexuellen Missbrauchs durch eine Minderheit von Priestern zu nutzen, um die Hierarchie der Macht in der Kirche zu dekonstruieren, indem er nicht mehr von der Spitze, sondern vom „Volk Gottes“ ausgeht. Nämlich die Laien an der Basis, die aufgrund ihrer „Würde als Getaufte“ „Rechte“ haben, um den „Klerikalismus“ zu bekämpfen, um die Evangelisierung zu erneuern.“ Und weiter: „Neben dieser völligen Umkehrung der hierarchischen Pyramide der „katholischen Kirche“ – die nur zehnmal erwähnt wird –, die zu einer „synodalen Kirche“ werden will – dieser Name taucht hundertundzehnmal im Text auf –, sind die inhaltlichen Anliegen keine Überraschung. Sie überschneiden sich mit allen Akzenten des Pontifikats von Papst Franziskus.“ Nämlich mit den Schwerpunkten der Armen, der Migranten, der Aufnahme aller, das heißt „geschiedene und wiederverheiratete Personen, polygame Personen oder LGBTQ+-Personen“.
Darüber hinaus will dieses revolutionäre Projekt im Kirchenrecht, dem kanonischen Recht, verankert werden. „Eine konstitutiv synodale Kirche ist dazu berufen, das Recht aller, kraft ihrer Taufe am Leben und an der Sendung der Kirche teilzunehmen, mit dem Dienst der Autorität und der Ausübung der Verantwortung zu verknüpfen.
Katholische Gläubige hatten Pflichten, jetzt haben sie Rechte. Es ist wichtig, „die kirchenrechtlichen Strukturen und die pastoralen Verfahren zu ändern, um Mitverantwortung und Transparenz zu fördern“, insbesondere durch die Schaffung von „Gruppierungen von Ortskirchen“, aber auch von „kontinentalen Instanzen“ der Kirche, damit zusammen mit „den Bischofskonferenzen“ die „Lehrautorität“ dezentralisiert werden kann.“
Schließlich empfiehlt diese Revolution eine Methode, mit der sie ihre Ziele erreichen kann. Der französische Vatikanist weist darauf hin: „Zum ersten Mal beschreibt dieses Arbeitsdokument den neuen kollektiven Entscheidungsprozess, den die Synode praktiziert sehen möchte und der „vom Seminar an“ gelehrt werden soll, um sicherzustellen, dass Priester und Bischöfe keine dominante Position mehr einnehmen, um eine Haltung des „Dienstes“ an den Gläubigen zu kultivieren.
Im Zentrum dieses neuen Systems steht eine Methode, die als „Gespräch im Geist“ bezeichnet wird. Es wird sogar ein erklärendes Schema veröffentlicht, das ihre drei Phasen nach einer „Gebetszeit“ erläutert: „Das Wort ergreifen und aufmerksam auf den Beitrag der anderen hören“, dann „dem anderen und dem Anderen Raum geben“ und sagen, was „am meisten widerhallt“ oder „den meisten Widerstand hervorgerufen hat.“ Schließlich „gemeinsam aufbauen“, indem „Intuitionen und Übereinstimmungen anerkannt“ und „Unstimmigkeiten und Hindernisse identifiziert“ werden, aber „prophetische Stimmen zum Vorschein kommen“, da es wichtig ist, dass „jeder sich durch das Ergebnis der Arbeit vertreten fühlt“. Der Text präzisiert: „Es geht nicht darum, auf das Gehörte zu reagieren oder ihm entgegenzuwirken, sondern darum, das auszudrücken, was beim Zuhören berührt oder herausgefordert hat.““
Denn, so heißt es in dem Dokument weiter, „die Auswirkungen des Zuhörens im inneren Raum eines jeden sind die Sprache, mit der der Heilige Geist seine eigene Stimme erklingen lässt.“ Und diese Methode sollte auf allen Ebenen in der Kirche angewandt werden, indem die Funktion eines „Moderators für gemeinsame Unterscheidungsprozesse“ geschaffen wird.
Wie man sich denken kann, hat dieses Arbeitspapier viele kritische Kommentare in der Presse hervorgerufen.
Was sind die charakteristischen Merkmale einer synodalen Kirche?
Unter dem expliziten Titel Synodalität als Ausdruck einer „flüssigen“, flexiblen Kirche beschreibt Stefano Fontana in La Nuova Bussola Quotidiana vom 21. Juni, was eine „synodale Kirche“ in den eigenen Worten des Instrumentum laboris ist: „Da die Synodalität als ein Prozess betrachtet wird, der aus der aktiven Teilnahme des Volkes Gottes resultiert, und somit als eine aktive Erfahrung und Praxis, charakterisiert das Arbeitsdokument der Synode die „synodale Kirche“ durch die Haltungen, die angenommen werden sollen, die Praxis, die verwirklicht werden soll.
Eine davon ist das Zuhören: Die synodale Kirche ist eine Kirche des Zuhörens. Eine andere ist die Demut: Die synodale Kirche ist eine Kirche, die weiß, dass sie viel zu lernen hat. Ein drittes ist die Haltung der Begegnung und des Dialogs mit allen (natürlich auch mit Bezug auf die ökologische Dringlichkeit).
Dann folgt das Merkmal einer Kirche, die keine Angst vor der Wahrheit hat, deren Trägerin sie ist, die diese aber zur Geltung bringt, ohne die Uniformität zu erzwingen (eine plurale Kirche, könnte man meinen ... aber plural wie?). Sie könnte dann nicht umhin, eine einladende Kirche zu sein, die für alle offen ist. Und schließlich, das extravaganteste Merkmal: eine Kirche, die mit der gesunden Sorge der Unvollständigkeit zu tun hat.“ Fontana schloss: „Es wird nicht schwer fallen, in diesen Ausdrücken den Mangel an theologischer Kohärenz zu sehen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass das Instrumentum laboris ein „flüssiger“ Text ist, der als solcher für jede Schlussfolgerung offen bleibt, selbst für die revolutionärste.
Ein Text, durch den man alles erwarten kann. Ein Zufall? Nein, denn der Kern von allem ist der Prozess, der das konstituierende Element der Synodalität ist. Die Liquidität fördert den Prozess, die Ersetzung der Wahrheit durch die Beziehung; das Wie, das Vorrang vor dem Was und Warum hat.“
Das Instrumentum laboris zielt auf die Rekonfiguration der Kirche ab
In seinem Blog Settimo Cielo bemerkte Sandro Magister am 28. Juni, dass das Instrumentum laboris den Heiligen Geist instrumentalisiert, um die neue synodale Kirche zu fördern. Unter der Überschrift „Gespräch im Geist – eine Synode ohne Sinn und Verstand“, schreibt der italienische Vatikanist: „Die Formel „Gespräch im Geist“ wurde von den beiden Kardinälen, die die Synode leiten, Mario Grech aus Malta und Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg, als Leitmotiv für die nächste Plenarsitzung der Synode im Oktober eingeführt. Im Instrumentum laboris, das als Rahmen für die Assisen dienen soll und am 20. Juni veröffentlicht wurde, taucht die Formulierung mehrfach auf.
Und in der Pressekonferenz zur Präsentation wurde sie sogar als Modus Operandi der Synode selbst identifiziert. [...] Aber wird diese Synode wirklich ein Ende haben? Angesichts der Art und Weise, wie Franziskus sie bislang gesteuert hat, und solange er Papst ist, ist dies zu bezweifeln. Franziskus ist vor allem an einer Sache interessiert: „Prozesse“ in Gang zu setzen. Von unbestimmter Dauer. Es ist ihm egal, ob sie verwirrend und verwirrend sind, denn der Heilige Geist wird wissen, wohin er die Kirche führen muss,“
In der letzten Ausgabe von La Civiltà Cattolica, der Jesuitenzeitschrift in Rom, die unter der Kontrolle der vatikanischen Behörden gedruckt wird, findet sich ein Artikel von Jos Moons, einem Jesuiten der Universität Löwen, der schon in der Überschrift alles sagt: „Papst Franziskus, der Heilige Geist und die Synodalität. Auf dem Weg zu einer pneumatologischen Neukonfiguration der Kirche“. Das sehr vage definierte „Gespräch im Geist“, das im Instrumentum laboris beschrieben wird, ist die Umsetzung dieser „Neukonfiguration“. Wo alles erlaubt ist, in einem Triumph der Meinungsfreiheit und in einer ostentativen Ehrfurcht vor dem Geist, der „weht, wo er will“.“
Wenn die „hörende Kirche“ autistisch wird
Auf der Website Silere non possumus, die ganz offensichtlich von Informationen profitiert, die aus den engsten Quellen der römischen Macht stammen, konnte man am 23. Juni folgende Enthüllung über den Verlauf der Konferenz zur Vorstellung des Instrumentum laboris am 20. Juni lesen: „Die Forderungen des gemäßigten Katholizismus wurden überhaupt nicht berücksichtigt.
Noch weniger wurden die der traditionelleren oder traditionalistischen Katholiken berücksichtigt. Letztere haben stets die möglichen Auswüchse der Synode angeprangert... Im Lichte der Ereignisse wird es immer schwieriger, ihnen Unrecht zu geben. Als bei der Pressekonferenz ein mutiger Journalist es wagte, nach dem Grund für die Abwesenheiten zu fragen, wurde ihm geantwortet: „Wir hören allen zu.“ Das ist so, als würde ich jemandem, der mich fragt „Wie geht es Ihrer Gesundheit?“ antworten, dass „die Ärzte eigentlich sehr gut sind“! Es ist unmöglich zu wissen, ob die Leute im Sekretariat der Synode dumm oder intelligent sind.“ Beiläufig ist eingefügt: „Der Heilige Geist wird immer wieder erwähnt. Aber es wird nie gesagt, dass dieser Geist der Geist Christi ist, der uns an das erinnert, was der Meister uns gelehrt hat.“
(Quellen: Le Figaro/La Nuova Bussola Quotidiana/Settimo Cielo/Silere non possumus/DICI n°434 – FSSPX.Actualités)
Illustration: synod.va